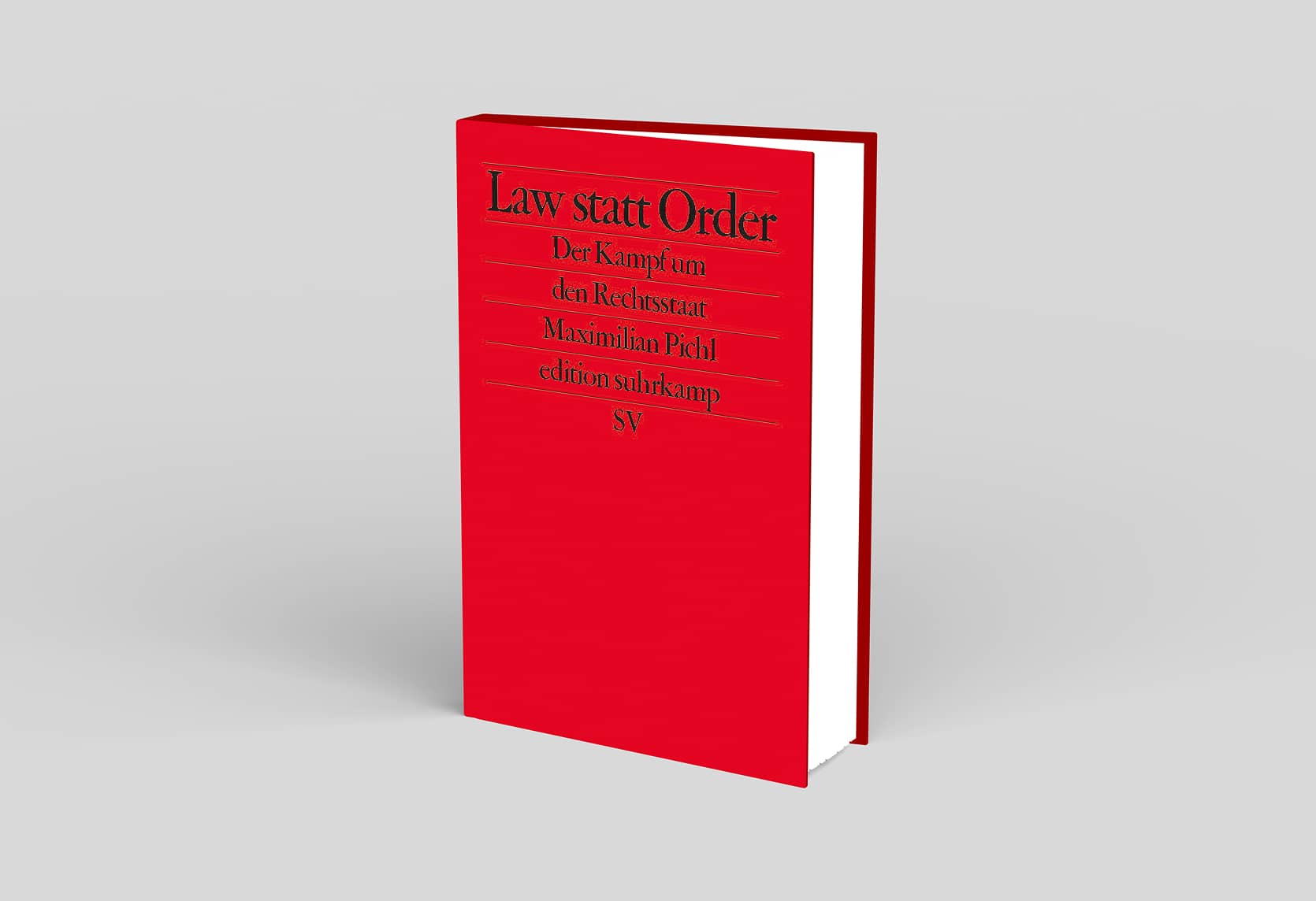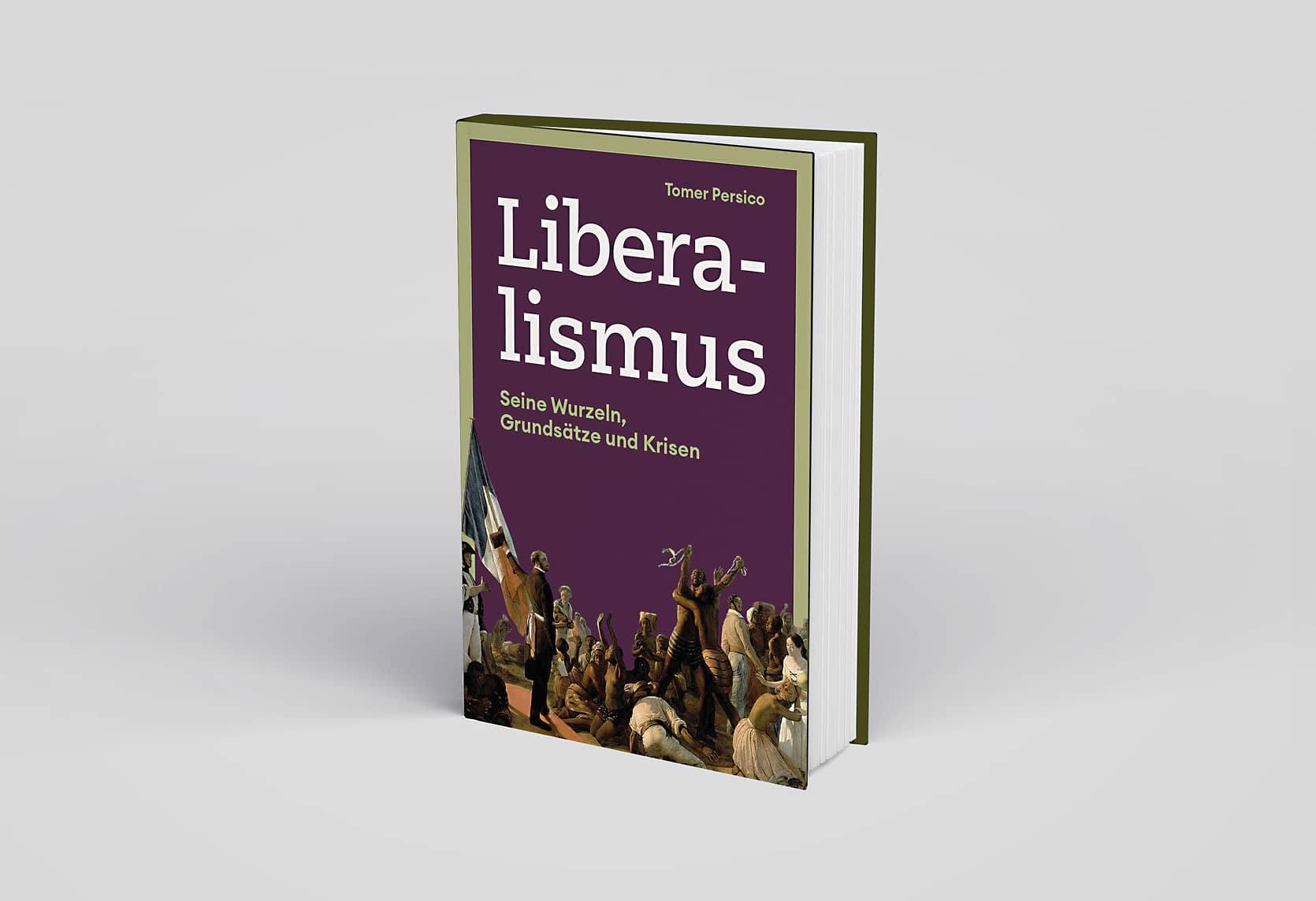„Ich werde den Wohlstand meiner Eltern nicht halten können“ – Mythos oder Realität?
Deutschlands Wirtschaft gilt als robust. Doch viele junge Menschen erleben das Gegenteil: steigende Lebenshaltungskosten, stagnierende Reallöhne und unerschwingliche Immobilienpreise.

Moritz hat alles richtig gemacht: Kaum 23 Jahre alt, wird er im kommenden Jahr seinen Bachelor an der Hochschule St. Gallen machen. Mit seinen vier besten Freunden aus dem Gymnasium ist er immer noch sehr eng, alle aus der Gruppe würden sich als sehr leistungsbereit und engagiert beschreiben. Dennoch geht es momentan oft um düstere Themen, wenn der Süddeutsche seine Clique sieht. „Wir gehen alle davon aus, dass es richtig schwer für uns werden wird, gute Jobs zu finden“, sagt er. Klar lande seine Bewerbung als Absolvent einer internationalen Eliteuni oben auf dem Stapel, meint Moritz: „Doch die laden dann 50 ein und nehmen zwei.“Als Peter vor einem knappen Jahrzehnt gegen Hunderte Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmeprüfung an einer renommierten deutschen Filmakademie geschafft hatte, sagten alle dem heute 28-Jährigen, er habe das große Los gezogen. Egal, ob er später beim Film oder in der Werbung arbeiten werde – wer von dieser Filmakademie komme, sei überall in der Welt willkommen. Peter koordiniert und programmiert heute von Berlin aus innovative Video-Animationen für eine angesagte Eventlocation in den USA. Er verdiene „gutes Geld“, sagt er. Doch es nagt an ihm: „Alle in meiner Familie wohnen in eigenen Häusern. Für mich ist das ohne Erbe, nur mit meiner Arbeit, völlig utopisch.“Wenn Peter sich mit seinem Freundeskreis trifft und das Gespräch auf die Zukunft ihrer Generation kommt, endet das oft in Frust. „Mega unfair“ sei das alles. „Das Vertrauen, dass es besser wird und Leistung sich lohnt, ist nicht da“, sagt seine Freundin Isa. Wie ihre Freunde ziehen beide derzeit als Fazit: „Wir haben die guten Jahre verpasst.“
Warum die Generation Z am eigenen Wohlstand zweifelt
Willkommen in der neuen Welt. Auch das ist ein Originalzitat aus Gesprächen mit jungen Menschen. Viele erleben diese neue Welt als eine, in der sie den Wohlstand ihrer Eltern nicht halten können. Egal, wie leistungsbereit sie sind. Egal, wie sehr sie sich anstrengen. Wenn sie über ihre Realität reden, sprechen sie über steigende Lebenshaltungskosten, stagnierende Reallöhne und unerschwingliche Immobilienpreise. Doch ist das die Realität? Oder ist es nicht doch eher eine verklärte Sicht auf eine Vergangenheit, in der tatsächlich viele Immobilien auf Muskelhypotheken und jahrelangem Konsumverzicht gebaut waren? Die angesichts durchaus akzeptabel verlaufener Elternkarrieren vergisst, wie umkämpft auch in der Boomer-Generation die Einstiegsjobs vor 30, 40 Jahren waren? Was ist wirklich dran am Gefühl, den Wohlstand der Eltern nicht halten zu können? Auf der Makroebene sind die Zahlen für Deutschland, insbesondere im europäischen Vergleich, trotz der wirtschaftlichen Stagnation der letzten drei Jahre noch immer gut. Bis Corona war auch die Inflation kaum ein Problem. Jahrelang lag sie sogar unter dem Wert von zwei Prozent, den die Europäische Zentralbank als Zielmarke für ihre Politik ausgesucht hat. Der weltweite Shutdown der Wirtschaft in Zuge von Corona, die folgenden Probleme mit den Lieferketten und dann vor allem der Energiepreisschock nach dem Beginn des Ukraine-Krieges haben das allerdings komplett geändert: Von 0,5 Prozent Inflation im Jahr 2020 schossen die Preise in den folgenden drei Jahren um insgesamt fast 16 Prozent nach oben. Vor allem bei Lebensmitteln, die jeder oft kauft, macht sich das bemerkbar. Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln berechnet deshalb seit 2021 im Winter den sogenannten Kartoffelsalat-Index, weil es in 36 Prozent der Haushalte hierzulande Kartoffelsalat mit Würstchen zu Weihnachten gibt. Allein für 2023 registrierten die Forschenden ein Plus von 4,7 Prozent. Im Jahr 2024 stiegen die Preise noch einmal um 4,6 Prozent.
Warum junge Menschen es schwerer haben
Derart starke Preissteigerungen setzen sich bei allen im Gedächtnis fest – und vor allem bei der jungen Generation. Für sie ist es das erste Mal im Leben, dass alles abrupt real so viel teurer wird. Denn in den ersten zwei Dekaden dieses Jahrhunderts haben sich Preise und Löhne weitestgehend im Einklang entwickelt: Stiegen die Preise, zogen kurz danach auch die Löhne an. Das zeigt auch der „Magnum-Index“, den das IW jeden Sommer berechnet: Das nach wie vor beliebteste Eis in Deutschland kostete im Jahr 2000 im Schnitt 1,28 Euro. Eine Käuferin musste dafür im Schnitt 6 Minuten und sieben Sekunden arbeiten. 2020 hatte sich der Preis auf 2 Euro 20 Cent fast verdoppelt, die notwendige Arbeitszeit dafür erhöhte sich allerdings nur um 21 Sekunden. Preise und Löhne entwickelten sich also weitgehend parallel. Für die Multikrisenjahre 2020 bis 2025 lässt sich das nicht mehr sagen: Der Preis zog um rund 30 Prozent an, und die für den Kauf notwendige Arbeitszeit schnellte auf fast sieben Minuten (6:53) nach oben. De facto muss heute also jeder eine knappe Minute länger arbeiten als noch vor einem Vierteljahrhundert, um sich ein Magnum zu leisten. Für Alexander sind die „sehr hohen Lebenshaltungskosten“ deshalb auch unstrittig. Der 28-Jährige arbeitet seit einigen Jahren in der Steuerberatung, seinen Job hält er angesichts des „extremen Fachkräftemangels für super krisensicher“. Dennoch sagt auch er, der Vermögensaufbau sei für seine Generation schwierig: „Meine Eltern haben sich in meinem Alter ihr erstes Haus für damals 250 000 DM gekauft. Mich würde das in meiner Heimatregion heute 700 000 Euro kosten, wenn ich es mir denn leisten könnte.“ Nun lebt Alexander zwar in der schönen, aber auch sehr teuren Bodensee-Region. Doch die Immobilienfrage ist für die Jungen absolut zentral, wenn es um die Einschätzung ihrer Zukunftschancen geht. Insbesondere die sozialen Medien sind voll davon. „Da gibt es jede Menge Memes von Boomern, die ihr Leben lang wenig verdient haben und sich trotzdem ein Haus leisten konnten“, erzählt Peter. Oder auch Posts, was Häuser in anderen Ländern so kosten oder mit welchen Tricks man doch noch irgendwie an die ersehnte Wohnung kommen könnte. In seinem Freundeskreis seien Hauspreise oft ein Thema, sagt der Filmspezialist: „Das ist schon so etwas wie ein Milestone, für meine Generation ist das wichtig.“
Die ewige Mietergeneration?
Tatsächlich ist die Wohneigentumsquote bei den unter 50-Jährigen zwischen 2011 und 2022 um mehr als vier Punkte auf 30,4 Prozent gesunken. Unter den Älteren ist sie mit 57 Prozent mittlerweile beinahe doppelt so hoch. Insbesondere in Wachstumsregionen und beliebten Städten sind die Immobilienpreise so überdurchschnittlich gestiegen, dass sich „der Zugang zu Wohneigentum für jüngere Menschen erheblich verschärft“ hat, wie das IW Ende 2024 in einer ausführlichen Analyse mit dem Untertitel „Generation Miete als Folge des Immobilienbooms?“ schreibt. Dieses Phänomen der „Generation Miete“ ist auch in anderen europäischen Ländern und den USA zu finden – und führt dort zu wachsender Besorgnis. Zwar würde jede Generation die jeweils nachfolgende gern als „faul“ und „unzuverlässig“ geißeln, schreibt John Burn-Murdoch in der „Financial Times“ (FT). Doch die Generation Z treffe das noch mehr als andere: Statt sich gegen die pauschalen Verurteilungen zu wehren, würden sie „sie umarmen“, beispielsweise durch stille Arbeitsverweigerung wie das selbst in China zunehmend beliebte „Quiet Quitting“. Vielleicht noch besorgniserregender sei, dass der zerplatzende Traum einer eigenen Immobilie unvernünftige finanzielle Entscheidungen fördere.
„Meine Eltern haben sich in meinem Alter ihr erstes Haus für damals 250 000 DM gekauft. Mich würde das in meiner Heimatregion heute 700 000 Euro kosten, wenn ich es mir denn leisten könnte.“
So haben Ökonomen der University of Chicago und der Northwestern University in einer Ende November 2025 vorgestellten Studie herausgefunden, dass „reduzierter Arbeitsanreiz, erhöhte Freizeitausgaben und Investment in riskante Finanzanlagen“ bei denjenigen überdurchschnittlich häufig festzustellen sind, die für sich keine Chancen auf Immobilienbesitz sehen. Für sich genommen sei das sogar eine „rationale Verhaltensweise“, schreiben die Ökonomen. Für die Gesellschaft als Ganzes jedoch sei es brandgefährlich, weil das Leistungsversprechen gebrochen werde, so FT-Autor Burn-Murdoch: „Wenn die Belohnung, ein eigenes Haus zu besitzen, unerreichbar geworden ist, fühlt sich das Ganze sinnlos an.“ Möglicherweise ist diese Analyse für Deutschland noch zu früh, da derartige Trends uns erstens immer mit zeitlicher Verzögerung erreichen und zweitens die Immobilien-Eigentumsquote in Deutschland viel niedriger liegt als in den USA und Großbritannien. Doch der bange Blick auf die Zukunft sollte ernst genommen werden. „In den Nullerjahren verschwand die Zukunft“, zitiert die „Zeit“ die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub. Die Militärexpertin nimmt dabei Bezug auf alle Reden, die im Bundestag zwischen 1949 und 2021 gehalten wurden und die man computerlinguistisch untersucht hat. Seit der Finanzkrise 2008 werde die Zukunft „im besten Fall mit heute gleichgesetzt, im schlechtesten Fall als das Allerschlimmste beschrieben“. Das sei fatal, so Gaub, sollte doch „jeder Einzelne das Gefühl haben, die Zukunft positiv beeinflussen zu können, handeln zu können“.
Was Politik und Wirtschaft tun könnten
Exemplarisch dafür steht für fast alle Jungen die staatliche Rente. „Wir wissen alle, dass wir keine Rente bekommen“, ist noch einer der höflichen Sätze, die hier zu hören sind. „Ist für’n Arsch“ lautet eine der eher prägnanten Kurzformeln für etwas, das die jüngere Generation unisono als Ausdruck der „Rentnerrepublik, in der sich nichts mehr bewegt“ sieht. Allen Jungen ist mehr als bewusst, wie sehr sie an der Wahlurne in der Minderheit sind und auch bleiben werden. Große Skepsis löst auch das Zukunftsthema künstliche Intelligenz (KI) aus. „Klar nutzen wir KI täglich“, sagt beispielsweise Peter, „aber dabei ist uns natürlich bewusst, dass wir umso ersetzbarer werden, je effektiver wir die KI-Instrumente einsetzen.“ Ziemlich mulmig sei ihm dabei, „sehenden Auges meinen eigenen Job vielleicht abzuschaffen“. Angesichts all dieser Herausforderungen meldet die aktuelle Shell-Jugendstudie, dass der seit 2006 zu beobachtende „Trend einer immer größeren persönlichen Zuversicht unter Jugendlichen“ erstmals gebrochen sei: Nach 56 Prozent im Jahr 2019 blicken inzwischen nur noch 52 Prozent optimistisch auf ihre persönliche Zukunft. Richtiggehend gecrasht ist der Optimismus bei Jugendlichen aus der einkommensstärkeren oberen Schicht, nämlich von 76 Prozent im Jahr 2015 auf aktuell 55 Prozent. Zugelegt hat er jedoch bei Jugendlichen aus einfachen sozialen Verhältnissen, von denen inzwischen 47 Prozent „zuversichtlich in die eigene Zukunft blicken“. 2015 waren es nur 32 Prozent. Diese Zahlen sind insbesondere angesichts der sich weiter öffnenden Wohlstandsschere und der zunehmend ungleichen Vermögensverteilung kontraintuitiv. Möglicherweise sind sie aber auch ein weiterer Beleg für die These der Jungen, den Wohlstand ihrer Eltern nicht erreichen zu können – nämlich für all diejenigen, die aus der akademischen Mittelschicht kommen, deren Eltern erstmals in der Familiengeschichte einen Bildungsaufstieg erlebt haben und die jetzt mehr oder weniger zur Erbengesellschaft gehören.
Ihnen allen geht es materiell zwar eher gut, aber wirklich zufrieden sind sie nicht, denn sie fürchten, mit ihrer eigenen Arbeit ihre Wohlstandsziele nicht erreichen zu können. Das führe zu Resignation und „Ausfluchtsreaktionen“, hat Moritz beobachtet, der an der Hochschule St. Gallen studiert: „Einer meiner Bekannten hat jetzt zwei Bachelor gemacht, ist Mitte 20 und findet keinen adäquaten Job. Jetzt sagt er resigniert, dann werde er halt Lehrer.“ Ein anderer Bekannter im Marketing bei einem Mittelständler gehe nach exakt 35 Stunden nach Hause und verwirkliche sich inzwischen neun Stunden pro Woche mit der neuen Trendsportart Paddleball. Das Gegenteil ist Vanessa aufgefallen, die nächstes Jahr ihren Bachelor in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim beendet: „Bei mir im Jahrgang sind viele, die als Erste in ihrer Familie studieren und die so schnell wie möglich auf der Karriereleiter nach oben klettern wollen.“ Gerade weil sie wenig Geld von zu Hause mitbekommen haben, hätten sie ein duales Studium gewählt, bei dem sie parallel bereits in Unternehmen arbeiten und dafür auch bezahlt würden. Ihr Ziel sei oft „finanzielle Freiheit“, also so viel Vermögen anzuhäufen, dass sie von den Erträgen leben können. „FIRE“ nennt sich diese aus den USA kommende Bewegung auch in den sozialen Medien: „Financially Independent, Retire Early“. Auch hier aber dürfte die Enttäuschung vorprogrammiert sein. Nur die Allerwenigsten werden tatsächlich so diszipliniert sparen und erfolgreich anlegen, dass sie dann eher früher als später „finanziell frei“ werden. Alles Mist also für die Generation Z? Oder sind die alle einfach nur zu wehleidig, wie Moderator Markus Lanz meint? „Eine Guavendicksafttruppe, die die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist“, wie ihn „Zeit Campus“ zitiert? Mit einer Anspruchshaltung, die dem Ex-Bundesminister Thomas de Maizière „gegen den Strich“ geht: „Sie denken zu viel an sich und zu wenig an die Gesellschaft.“Wohl kaum. Eher stellt sich die Frage, ob die Politik genug an sie und ihre Zukunft denkt. Denn geboren wurde die aktuelle junge Generation in eine bereits sehr wohlhabende und zunehmend saturierte Gesellschaft. Für diejenigen, die wenig haben, ist der Aufstieg dann umso schwieriger. Für alle in der Mitte ist die Gefahr, abzusteigen, immer präsent. Und die an der Spitze haben zwar schon den goldenen Löffel. Doch der süße Brei aus dem Märchen der Gebrüder Grimm schmeckt damit eben auch nicht besser.
Moritz hat alles richtig gemacht: Kaum 23 Jahre alt, wird er im kommenden Jahr seinen Bachelor an der Hochschule St. Gallen machen. Mit seinen vier besten Freunden aus dem Gymnasium ist er immer noch sehr eng, alle aus der Gruppe würden sich als sehr leistungsbereit und engagiert beschreiben. Dennoch geht es momentan oft um düstere Themen, wenn der Süddeutsche seine Clique sieht. „Wir gehen alle davon aus, dass es richtig schwer für uns werden wird, gute Jobs zu finden“, sagt er. Klar lande seine Bewerbung als Absolvent einer internationalen Eliteuni oben auf dem Stapel, meint Moritz: „Doch die laden dann 50 ein und nehmen zwei.“Als Peter vor einem knappen Jahrzehnt gegen Hunderte Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmeprüfung an einer renommierten deutschen Filmakademie geschafft hatte, sagten alle dem heute 28-Jährigen, er habe das große Los gezogen. Egal, ob er später beim Film oder in der Werbung arbeiten werde – wer von dieser Filmakademie komme, sei überall in der Welt willkommen. Peter koordiniert und programmiert heute von Berlin aus innovative Video-Animationen für eine angesagte Eventlocation in den USA. Er verdiene „gutes Geld“, sagt er. Doch es nagt an ihm: „Alle in meiner Familie wohnen in eigenen Häusern. Für mich ist das ohne Erbe, nur mit meiner Arbeit, völlig utopisch.“Wenn Peter sich mit seinem Freundeskreis trifft und das Gespräch auf die Zukunft ihrer Generation kommt, endet das oft in Frust. „Mega unfair“ sei das alles. „Das Vertrauen, dass es besser wird und Leistung sich lohnt, ist nicht da“, sagt seine Freundin Isa. Wie ihre Freunde ziehen beide derzeit als Fazit: „Wir haben die guten Jahre verpasst.“
Warum die Generation Z am eigenen Wohlstand zweifelt
Willkommen in der neuen Welt. Auch das ist ein Originalzitat aus Gesprächen mit jungen Menschen. Viele erleben diese neue Welt als eine, in der sie den Wohlstand ihrer Eltern nicht halten können. Egal, wie leistungsbereit sie sind. Egal, wie sehr sie sich anstrengen. Wenn sie über ihre Realität reden, sprechen sie über steigende Lebenshaltungskosten, stagnierende Reallöhne und unerschwingliche Immobilienpreise. Doch ist das die Realität? Oder ist es nicht doch eher eine verklärte Sicht auf eine Vergangenheit, in der tatsächlich viele Immobilien auf Muskelhypotheken und jahrelangem Konsumverzicht gebaut waren? Die angesichts durchaus akzeptabel verlaufener Elternkarrieren vergisst, wie umkämpft auch in der Boomer-Generation die Einstiegsjobs vor 30, 40 Jahren waren? Was ist wirklich dran am Gefühl, den Wohlstand der Eltern nicht halten zu können? Auf der Makroebene sind die Zahlen für Deutschland, insbesondere im europäischen Vergleich, trotz der wirtschaftlichen Stagnation der letzten drei Jahre noch immer gut. Bis Corona war auch die Inflation kaum ein Problem. Jahrelang lag sie sogar unter dem Wert von zwei Prozent, den die Europäische Zentralbank als Zielmarke für ihre Politik ausgesucht hat. Der weltweite Shutdown der Wirtschaft in Zuge von Corona, die folgenden Probleme mit den Lieferketten und dann vor allem der Energiepreisschock nach dem Beginn des Ukraine-Krieges haben das allerdings komplett geändert: Von 0,5 Prozent Inflation im Jahr 2020 schossen die Preise in den folgenden drei Jahren um insgesamt fast 16 Prozent nach oben. Vor allem bei Lebensmitteln, die jeder oft kauft, macht sich das bemerkbar. Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln berechnet deshalb seit 2021 im Winter den sogenannten Kartoffelsalat-Index, weil es in 36 Prozent der Haushalte hierzulande Kartoffelsalat mit Würstchen zu Weihnachten gibt. Allein für 2023 registrierten die Forschenden ein Plus von 4,7 Prozent. Im Jahr 2024 stiegen die Preise noch einmal um 4,6 Prozent.
Warum junge Menschen es schwerer haben
Derart starke Preissteigerungen setzen sich bei allen im Gedächtnis fest – und vor allem bei der jungen Generation. Für sie ist es das erste Mal im Leben, dass alles abrupt real so viel teurer wird. Denn in den ersten zwei Dekaden dieses Jahrhunderts haben sich Preise und Löhne weitestgehend im Einklang entwickelt: Stiegen die Preise, zogen kurz danach auch die Löhne an. Das zeigt auch der „Magnum-Index“, den das IW jeden Sommer berechnet: Das nach wie vor beliebteste Eis in Deutschland kostete im Jahr 2000 im Schnitt 1,28 Euro. Eine Käuferin musste dafür im Schnitt 6 Minuten und sieben Sekunden arbeiten. 2020 hatte sich der Preis auf 2 Euro 20 Cent fast verdoppelt, die notwendige Arbeitszeit dafür erhöhte sich allerdings nur um 21 Sekunden. Preise und Löhne entwickelten sich also weitgehend parallel. Für die Multikrisenjahre 2020 bis 2025 lässt sich das nicht mehr sagen: Der Preis zog um rund 30 Prozent an, und die für den Kauf notwendige Arbeitszeit schnellte auf fast sieben Minuten (6:53) nach oben. De facto muss heute also jeder eine knappe Minute länger arbeiten als noch vor einem Vierteljahrhundert, um sich ein Magnum zu leisten. Für Alexander sind die „sehr hohen Lebenshaltungskosten“ deshalb auch unstrittig. Der 28-Jährige arbeitet seit einigen Jahren in der Steuerberatung, seinen Job hält er angesichts des „extremen Fachkräftemangels für super krisensicher“. Dennoch sagt auch er, der Vermögensaufbau sei für seine Generation schwierig: „Meine Eltern haben sich in meinem Alter ihr erstes Haus für damals 250 000 DM gekauft. Mich würde das in meiner Heimatregion heute 700 000 Euro kosten, wenn ich es mir denn leisten könnte.“ Nun lebt Alexander zwar in der schönen, aber auch sehr teuren Bodensee-Region. Doch die Immobilienfrage ist für die Jungen absolut zentral, wenn es um die Einschätzung ihrer Zukunftschancen geht. Insbesondere die sozialen Medien sind voll davon. „Da gibt es jede Menge Memes von Boomern, die ihr Leben lang wenig verdient haben und sich trotzdem ein Haus leisten konnten“, erzählt Peter. Oder auch Posts, was Häuser in anderen Ländern so kosten oder mit welchen Tricks man doch noch irgendwie an die ersehnte Wohnung kommen könnte. In seinem Freundeskreis seien Hauspreise oft ein Thema, sagt der Filmspezialist: „Das ist schon so etwas wie ein Milestone, für meine Generation ist das wichtig.“
Die ewige Mietergeneration?
Tatsächlich ist die Wohneigentumsquote bei den unter 50-Jährigen zwischen 2011 und 2022 um mehr als vier Punkte auf 30,4 Prozent gesunken. Unter den Älteren ist sie mit 57 Prozent mittlerweile beinahe doppelt so hoch. Insbesondere in Wachstumsregionen und beliebten Städten sind die Immobilienpreise so überdurchschnittlich gestiegen, dass sich „der Zugang zu Wohneigentum für jüngere Menschen erheblich verschärft“ hat, wie das IW Ende 2024 in einer ausführlichen Analyse mit dem Untertitel „Generation Miete als Folge des Immobilienbooms?“ schreibt. Dieses Phänomen der „Generation Miete“ ist auch in anderen europäischen Ländern und den USA zu finden – und führt dort zu wachsender Besorgnis. Zwar würde jede Generation die jeweils nachfolgende gern als „faul“ und „unzuverlässig“ geißeln, schreibt John Burn-Murdoch in der „Financial Times“ (FT). Doch die Generation Z treffe das noch mehr als andere: Statt sich gegen die pauschalen Verurteilungen zu wehren, würden sie „sie umarmen“, beispielsweise durch stille Arbeitsverweigerung wie das selbst in China zunehmend beliebte „Quiet Quitting“. Vielleicht noch besorgniserregender sei, dass der zerplatzende Traum einer eigenen Immobilie unvernünftige finanzielle Entscheidungen fördere.
„Meine Eltern haben sich in meinem Alter ihr erstes Haus für damals 250 000 DM gekauft. Mich würde das in meiner Heimatregion heute 700 000 Euro kosten, wenn ich es mir denn leisten könnte.“
So haben Ökonomen der University of Chicago und der Northwestern University in einer Ende November 2025 vorgestellten Studie herausgefunden, dass „reduzierter Arbeitsanreiz, erhöhte Freizeitausgaben und Investment in riskante Finanzanlagen“ bei denjenigen überdurchschnittlich häufig festzustellen sind, die für sich keine Chancen auf Immobilienbesitz sehen. Für sich genommen sei das sogar eine „rationale Verhaltensweise“, schreiben die Ökonomen. Für die Gesellschaft als Ganzes jedoch sei es brandgefährlich, weil das Leistungsversprechen gebrochen werde, so FT-Autor Burn-Murdoch: „Wenn die Belohnung, ein eigenes Haus zu besitzen, unerreichbar geworden ist, fühlt sich das Ganze sinnlos an.“ Möglicherweise ist diese Analyse für Deutschland noch zu früh, da derartige Trends uns erstens immer mit zeitlicher Verzögerung erreichen und zweitens die Immobilien-Eigentumsquote in Deutschland viel niedriger liegt als in den USA und Großbritannien. Doch der bange Blick auf die Zukunft sollte ernst genommen werden. „In den Nullerjahren verschwand die Zukunft“, zitiert die „Zeit“ die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub. Die Militärexpertin nimmt dabei Bezug auf alle Reden, die im Bundestag zwischen 1949 und 2021 gehalten wurden und die man computerlinguistisch untersucht hat. Seit der Finanzkrise 2008 werde die Zukunft „im besten Fall mit heute gleichgesetzt, im schlechtesten Fall als das Allerschlimmste beschrieben“. Das sei fatal, so Gaub, sollte doch „jeder Einzelne das Gefühl haben, die Zukunft positiv beeinflussen zu können, handeln zu können“.
Was Politik und Wirtschaft tun könnten
Exemplarisch dafür steht für fast alle Jungen die staatliche Rente. „Wir wissen alle, dass wir keine Rente bekommen“, ist noch einer der höflichen Sätze, die hier zu hören sind. „Ist für’n Arsch“ lautet eine der eher prägnanten Kurzformeln für etwas, das die jüngere Generation unisono als Ausdruck der „Rentnerrepublik, in der sich nichts mehr bewegt“ sieht. Allen Jungen ist mehr als bewusst, wie sehr sie an der Wahlurne in der Minderheit sind und auch bleiben werden. Große Skepsis löst auch das Zukunftsthema künstliche Intelligenz (KI) aus. „Klar nutzen wir KI täglich“, sagt beispielsweise Peter, „aber dabei ist uns natürlich bewusst, dass wir umso ersetzbarer werden, je effektiver wir die KI-Instrumente einsetzen.“ Ziemlich mulmig sei ihm dabei, „sehenden Auges meinen eigenen Job vielleicht abzuschaffen“. Angesichts all dieser Herausforderungen meldet die aktuelle Shell-Jugendstudie, dass der seit 2006 zu beobachtende „Trend einer immer größeren persönlichen Zuversicht unter Jugendlichen“ erstmals gebrochen sei: Nach 56 Prozent im Jahr 2019 blicken inzwischen nur noch 52 Prozent optimistisch auf ihre persönliche Zukunft. Richtiggehend gecrasht ist der Optimismus bei Jugendlichen aus der einkommensstärkeren oberen Schicht, nämlich von 76 Prozent im Jahr 2015 auf aktuell 55 Prozent. Zugelegt hat er jedoch bei Jugendlichen aus einfachen sozialen Verhältnissen, von denen inzwischen 47 Prozent „zuversichtlich in die eigene Zukunft blicken“. 2015 waren es nur 32 Prozent. Diese Zahlen sind insbesondere angesichts der sich weiter öffnenden Wohlstandsschere und der zunehmend ungleichen Vermögensverteilung kontraintuitiv. Möglicherweise sind sie aber auch ein weiterer Beleg für die These der Jungen, den Wohlstand ihrer Eltern nicht erreichen zu können – nämlich für all diejenigen, die aus der akademischen Mittelschicht kommen, deren Eltern erstmals in der Familiengeschichte einen Bildungsaufstieg erlebt haben und die jetzt mehr oder weniger zur Erbengesellschaft gehören.
Ihnen allen geht es materiell zwar eher gut, aber wirklich zufrieden sind sie nicht, denn sie fürchten, mit ihrer eigenen Arbeit ihre Wohlstandsziele nicht erreichen zu können. Das führe zu Resignation und „Ausfluchtsreaktionen“, hat Moritz beobachtet, der an der Hochschule St. Gallen studiert: „Einer meiner Bekannten hat jetzt zwei Bachelor gemacht, ist Mitte 20 und findet keinen adäquaten Job. Jetzt sagt er resigniert, dann werde er halt Lehrer.“ Ein anderer Bekannter im Marketing bei einem Mittelständler gehe nach exakt 35 Stunden nach Hause und verwirkliche sich inzwischen neun Stunden pro Woche mit der neuen Trendsportart Paddleball. Das Gegenteil ist Vanessa aufgefallen, die nächstes Jahr ihren Bachelor in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim beendet: „Bei mir im Jahrgang sind viele, die als Erste in ihrer Familie studieren und die so schnell wie möglich auf der Karriereleiter nach oben klettern wollen.“ Gerade weil sie wenig Geld von zu Hause mitbekommen haben, hätten sie ein duales Studium gewählt, bei dem sie parallel bereits in Unternehmen arbeiten und dafür auch bezahlt würden. Ihr Ziel sei oft „finanzielle Freiheit“, also so viel Vermögen anzuhäufen, dass sie von den Erträgen leben können. „FIRE“ nennt sich diese aus den USA kommende Bewegung auch in den sozialen Medien: „Financially Independent, Retire Early“. Auch hier aber dürfte die Enttäuschung vorprogrammiert sein. Nur die Allerwenigsten werden tatsächlich so diszipliniert sparen und erfolgreich anlegen, dass sie dann eher früher als später „finanziell frei“ werden. Alles Mist also für die Generation Z? Oder sind die alle einfach nur zu wehleidig, wie Moderator Markus Lanz meint? „Eine Guavendicksafttruppe, die die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist“, wie ihn „Zeit Campus“ zitiert? Mit einer Anspruchshaltung, die dem Ex-Bundesminister Thomas de Maizière „gegen den Strich“ geht: „Sie denken zu viel an sich und zu wenig an die Gesellschaft.“Wohl kaum. Eher stellt sich die Frage, ob die Politik genug an sie und ihre Zukunft denkt. Denn geboren wurde die aktuelle junge Generation in eine bereits sehr wohlhabende und zunehmend saturierte Gesellschaft. Für diejenigen, die wenig haben, ist der Aufstieg dann umso schwieriger. Für alle in der Mitte ist die Gefahr, abzusteigen, immer präsent. Und die an der Spitze haben zwar schon den goldenen Löffel. Doch der süße Brei aus dem Märchen der Gebrüder Grimm schmeckt damit eben auch nicht besser.
Moritz hat alles richtig gemacht: Kaum 23 Jahre alt, wird er im kommenden Jahr seinen Bachelor an der Hochschule St. Gallen machen. Mit seinen vier besten Freunden aus dem Gymnasium ist er immer noch sehr eng, alle aus der Gruppe würden sich als sehr leistungsbereit und engagiert beschreiben. Dennoch geht es momentan oft um düstere Themen, wenn der Süddeutsche seine Clique sieht. „Wir gehen alle davon aus, dass es richtig schwer für uns werden wird, gute Jobs zu finden“, sagt er. Klar lande seine Bewerbung als Absolvent einer internationalen Eliteuni oben auf dem Stapel, meint Moritz: „Doch die laden dann 50 ein und nehmen zwei.“Als Peter vor einem knappen Jahrzehnt gegen Hunderte Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmeprüfung an einer renommierten deutschen Filmakademie geschafft hatte, sagten alle dem heute 28-Jährigen, er habe das große Los gezogen. Egal, ob er später beim Film oder in der Werbung arbeiten werde – wer von dieser Filmakademie komme, sei überall in der Welt willkommen. Peter koordiniert und programmiert heute von Berlin aus innovative Video-Animationen für eine angesagte Eventlocation in den USA. Er verdiene „gutes Geld“, sagt er. Doch es nagt an ihm: „Alle in meiner Familie wohnen in eigenen Häusern. Für mich ist das ohne Erbe, nur mit meiner Arbeit, völlig utopisch.“Wenn Peter sich mit seinem Freundeskreis trifft und das Gespräch auf die Zukunft ihrer Generation kommt, endet das oft in Frust. „Mega unfair“ sei das alles. „Das Vertrauen, dass es besser wird und Leistung sich lohnt, ist nicht da“, sagt seine Freundin Isa. Wie ihre Freunde ziehen beide derzeit als Fazit: „Wir haben die guten Jahre verpasst.“
Warum die Generation Z am eigenen Wohlstand zweifelt
Willkommen in der neuen Welt. Auch das ist ein Originalzitat aus Gesprächen mit jungen Menschen. Viele erleben diese neue Welt als eine, in der sie den Wohlstand ihrer Eltern nicht halten können. Egal, wie leistungsbereit sie sind. Egal, wie sehr sie sich anstrengen. Wenn sie über ihre Realität reden, sprechen sie über steigende Lebenshaltungskosten, stagnierende Reallöhne und unerschwingliche Immobilienpreise. Doch ist das die Realität? Oder ist es nicht doch eher eine verklärte Sicht auf eine Vergangenheit, in der tatsächlich viele Immobilien auf Muskelhypotheken und jahrelangem Konsumverzicht gebaut waren? Die angesichts durchaus akzeptabel verlaufener Elternkarrieren vergisst, wie umkämpft auch in der Boomer-Generation die Einstiegsjobs vor 30, 40 Jahren waren? Was ist wirklich dran am Gefühl, den Wohlstand der Eltern nicht halten zu können? Auf der Makroebene sind die Zahlen für Deutschland, insbesondere im europäischen Vergleich, trotz der wirtschaftlichen Stagnation der letzten drei Jahre noch immer gut. Bis Corona war auch die Inflation kaum ein Problem. Jahrelang lag sie sogar unter dem Wert von zwei Prozent, den die Europäische Zentralbank als Zielmarke für ihre Politik ausgesucht hat. Der weltweite Shutdown der Wirtschaft in Zuge von Corona, die folgenden Probleme mit den Lieferketten und dann vor allem der Energiepreisschock nach dem Beginn des Ukraine-Krieges haben das allerdings komplett geändert: Von 0,5 Prozent Inflation im Jahr 2020 schossen die Preise in den folgenden drei Jahren um insgesamt fast 16 Prozent nach oben. Vor allem bei Lebensmitteln, die jeder oft kauft, macht sich das bemerkbar. Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln berechnet deshalb seit 2021 im Winter den sogenannten Kartoffelsalat-Index, weil es in 36 Prozent der Haushalte hierzulande Kartoffelsalat mit Würstchen zu Weihnachten gibt. Allein für 2023 registrierten die Forschenden ein Plus von 4,7 Prozent. Im Jahr 2024 stiegen die Preise noch einmal um 4,6 Prozent.
Warum junge Menschen es schwerer haben
Derart starke Preissteigerungen setzen sich bei allen im Gedächtnis fest – und vor allem bei der jungen Generation. Für sie ist es das erste Mal im Leben, dass alles abrupt real so viel teurer wird. Denn in den ersten zwei Dekaden dieses Jahrhunderts haben sich Preise und Löhne weitestgehend im Einklang entwickelt: Stiegen die Preise, zogen kurz danach auch die Löhne an. Das zeigt auch der „Magnum-Index“, den das IW jeden Sommer berechnet: Das nach wie vor beliebteste Eis in Deutschland kostete im Jahr 2000 im Schnitt 1,28 Euro. Eine Käuferin musste dafür im Schnitt 6 Minuten und sieben Sekunden arbeiten. 2020 hatte sich der Preis auf 2 Euro 20 Cent fast verdoppelt, die notwendige Arbeitszeit dafür erhöhte sich allerdings nur um 21 Sekunden. Preise und Löhne entwickelten sich also weitgehend parallel. Für die Multikrisenjahre 2020 bis 2025 lässt sich das nicht mehr sagen: Der Preis zog um rund 30 Prozent an, und die für den Kauf notwendige Arbeitszeit schnellte auf fast sieben Minuten (6:53) nach oben. De facto muss heute also jeder eine knappe Minute länger arbeiten als noch vor einem Vierteljahrhundert, um sich ein Magnum zu leisten. Für Alexander sind die „sehr hohen Lebenshaltungskosten“ deshalb auch unstrittig. Der 28-Jährige arbeitet seit einigen Jahren in der Steuerberatung, seinen Job hält er angesichts des „extremen Fachkräftemangels für super krisensicher“. Dennoch sagt auch er, der Vermögensaufbau sei für seine Generation schwierig: „Meine Eltern haben sich in meinem Alter ihr erstes Haus für damals 250 000 DM gekauft. Mich würde das in meiner Heimatregion heute 700 000 Euro kosten, wenn ich es mir denn leisten könnte.“ Nun lebt Alexander zwar in der schönen, aber auch sehr teuren Bodensee-Region. Doch die Immobilienfrage ist für die Jungen absolut zentral, wenn es um die Einschätzung ihrer Zukunftschancen geht. Insbesondere die sozialen Medien sind voll davon. „Da gibt es jede Menge Memes von Boomern, die ihr Leben lang wenig verdient haben und sich trotzdem ein Haus leisten konnten“, erzählt Peter. Oder auch Posts, was Häuser in anderen Ländern so kosten oder mit welchen Tricks man doch noch irgendwie an die ersehnte Wohnung kommen könnte. In seinem Freundeskreis seien Hauspreise oft ein Thema, sagt der Filmspezialist: „Das ist schon so etwas wie ein Milestone, für meine Generation ist das wichtig.“
Die ewige Mietergeneration?
Tatsächlich ist die Wohneigentumsquote bei den unter 50-Jährigen zwischen 2011 und 2022 um mehr als vier Punkte auf 30,4 Prozent gesunken. Unter den Älteren ist sie mit 57 Prozent mittlerweile beinahe doppelt so hoch. Insbesondere in Wachstumsregionen und beliebten Städten sind die Immobilienpreise so überdurchschnittlich gestiegen, dass sich „der Zugang zu Wohneigentum für jüngere Menschen erheblich verschärft“ hat, wie das IW Ende 2024 in einer ausführlichen Analyse mit dem Untertitel „Generation Miete als Folge des Immobilienbooms?“ schreibt. Dieses Phänomen der „Generation Miete“ ist auch in anderen europäischen Ländern und den USA zu finden – und führt dort zu wachsender Besorgnis. Zwar würde jede Generation die jeweils nachfolgende gern als „faul“ und „unzuverlässig“ geißeln, schreibt John Burn-Murdoch in der „Financial Times“ (FT). Doch die Generation Z treffe das noch mehr als andere: Statt sich gegen die pauschalen Verurteilungen zu wehren, würden sie „sie umarmen“, beispielsweise durch stille Arbeitsverweigerung wie das selbst in China zunehmend beliebte „Quiet Quitting“. Vielleicht noch besorgniserregender sei, dass der zerplatzende Traum einer eigenen Immobilie unvernünftige finanzielle Entscheidungen fördere.
„Meine Eltern haben sich in meinem Alter ihr erstes Haus für damals 250 000 DM gekauft. Mich würde das in meiner Heimatregion heute 700 000 Euro kosten, wenn ich es mir denn leisten könnte.“
So haben Ökonomen der University of Chicago und der Northwestern University in einer Ende November 2025 vorgestellten Studie herausgefunden, dass „reduzierter Arbeitsanreiz, erhöhte Freizeitausgaben und Investment in riskante Finanzanlagen“ bei denjenigen überdurchschnittlich häufig festzustellen sind, die für sich keine Chancen auf Immobilienbesitz sehen. Für sich genommen sei das sogar eine „rationale Verhaltensweise“, schreiben die Ökonomen. Für die Gesellschaft als Ganzes jedoch sei es brandgefährlich, weil das Leistungsversprechen gebrochen werde, so FT-Autor Burn-Murdoch: „Wenn die Belohnung, ein eigenes Haus zu besitzen, unerreichbar geworden ist, fühlt sich das Ganze sinnlos an.“ Möglicherweise ist diese Analyse für Deutschland noch zu früh, da derartige Trends uns erstens immer mit zeitlicher Verzögerung erreichen und zweitens die Immobilien-Eigentumsquote in Deutschland viel niedriger liegt als in den USA und Großbritannien. Doch der bange Blick auf die Zukunft sollte ernst genommen werden. „In den Nullerjahren verschwand die Zukunft“, zitiert die „Zeit“ die Politikwissenschaftlerin Florence Gaub. Die Militärexpertin nimmt dabei Bezug auf alle Reden, die im Bundestag zwischen 1949 und 2021 gehalten wurden und die man computerlinguistisch untersucht hat. Seit der Finanzkrise 2008 werde die Zukunft „im besten Fall mit heute gleichgesetzt, im schlechtesten Fall als das Allerschlimmste beschrieben“. Das sei fatal, so Gaub, sollte doch „jeder Einzelne das Gefühl haben, die Zukunft positiv beeinflussen zu können, handeln zu können“.
Was Politik und Wirtschaft tun könnten
Exemplarisch dafür steht für fast alle Jungen die staatliche Rente. „Wir wissen alle, dass wir keine Rente bekommen“, ist noch einer der höflichen Sätze, die hier zu hören sind. „Ist für’n Arsch“ lautet eine der eher prägnanten Kurzformeln für etwas, das die jüngere Generation unisono als Ausdruck der „Rentnerrepublik, in der sich nichts mehr bewegt“ sieht. Allen Jungen ist mehr als bewusst, wie sehr sie an der Wahlurne in der Minderheit sind und auch bleiben werden. Große Skepsis löst auch das Zukunftsthema künstliche Intelligenz (KI) aus. „Klar nutzen wir KI täglich“, sagt beispielsweise Peter, „aber dabei ist uns natürlich bewusst, dass wir umso ersetzbarer werden, je effektiver wir die KI-Instrumente einsetzen.“ Ziemlich mulmig sei ihm dabei, „sehenden Auges meinen eigenen Job vielleicht abzuschaffen“. Angesichts all dieser Herausforderungen meldet die aktuelle Shell-Jugendstudie, dass der seit 2006 zu beobachtende „Trend einer immer größeren persönlichen Zuversicht unter Jugendlichen“ erstmals gebrochen sei: Nach 56 Prozent im Jahr 2019 blicken inzwischen nur noch 52 Prozent optimistisch auf ihre persönliche Zukunft. Richtiggehend gecrasht ist der Optimismus bei Jugendlichen aus der einkommensstärkeren oberen Schicht, nämlich von 76 Prozent im Jahr 2015 auf aktuell 55 Prozent. Zugelegt hat er jedoch bei Jugendlichen aus einfachen sozialen Verhältnissen, von denen inzwischen 47 Prozent „zuversichtlich in die eigene Zukunft blicken“. 2015 waren es nur 32 Prozent. Diese Zahlen sind insbesondere angesichts der sich weiter öffnenden Wohlstandsschere und der zunehmend ungleichen Vermögensverteilung kontraintuitiv. Möglicherweise sind sie aber auch ein weiterer Beleg für die These der Jungen, den Wohlstand ihrer Eltern nicht erreichen zu können – nämlich für all diejenigen, die aus der akademischen Mittelschicht kommen, deren Eltern erstmals in der Familiengeschichte einen Bildungsaufstieg erlebt haben und die jetzt mehr oder weniger zur Erbengesellschaft gehören.
Ihnen allen geht es materiell zwar eher gut, aber wirklich zufrieden sind sie nicht, denn sie fürchten, mit ihrer eigenen Arbeit ihre Wohlstandsziele nicht erreichen zu können. Das führe zu Resignation und „Ausfluchtsreaktionen“, hat Moritz beobachtet, der an der Hochschule St. Gallen studiert: „Einer meiner Bekannten hat jetzt zwei Bachelor gemacht, ist Mitte 20 und findet keinen adäquaten Job. Jetzt sagt er resigniert, dann werde er halt Lehrer.“ Ein anderer Bekannter im Marketing bei einem Mittelständler gehe nach exakt 35 Stunden nach Hause und verwirkliche sich inzwischen neun Stunden pro Woche mit der neuen Trendsportart Paddleball. Das Gegenteil ist Vanessa aufgefallen, die nächstes Jahr ihren Bachelor in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim beendet: „Bei mir im Jahrgang sind viele, die als Erste in ihrer Familie studieren und die so schnell wie möglich auf der Karriereleiter nach oben klettern wollen.“ Gerade weil sie wenig Geld von zu Hause mitbekommen haben, hätten sie ein duales Studium gewählt, bei dem sie parallel bereits in Unternehmen arbeiten und dafür auch bezahlt würden. Ihr Ziel sei oft „finanzielle Freiheit“, also so viel Vermögen anzuhäufen, dass sie von den Erträgen leben können. „FIRE“ nennt sich diese aus den USA kommende Bewegung auch in den sozialen Medien: „Financially Independent, Retire Early“. Auch hier aber dürfte die Enttäuschung vorprogrammiert sein. Nur die Allerwenigsten werden tatsächlich so diszipliniert sparen und erfolgreich anlegen, dass sie dann eher früher als später „finanziell frei“ werden. Alles Mist also für die Generation Z? Oder sind die alle einfach nur zu wehleidig, wie Moderator Markus Lanz meint? „Eine Guavendicksafttruppe, die die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist“, wie ihn „Zeit Campus“ zitiert? Mit einer Anspruchshaltung, die dem Ex-Bundesminister Thomas de Maizière „gegen den Strich“ geht: „Sie denken zu viel an sich und zu wenig an die Gesellschaft.“Wohl kaum. Eher stellt sich die Frage, ob die Politik genug an sie und ihre Zukunft denkt. Denn geboren wurde die aktuelle junge Generation in eine bereits sehr wohlhabende und zunehmend saturierte Gesellschaft. Für diejenigen, die wenig haben, ist der Aufstieg dann umso schwieriger. Für alle in der Mitte ist die Gefahr, abzusteigen, immer präsent. Und die an der Spitze haben zwar schon den goldenen Löffel. Doch der süße Brei aus dem Märchen der Gebrüder Grimm schmeckt damit eben auch nicht besser.